
CATEGORIES:
BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism
DER JOURNALISMUS LEBT - Essay
PUBLIZISTISCHE TEXTE
WIE ANALYSIERT MAN EINEN ARTIKEL?
Titel, Autor, Zeitung
- Den Titel und den Autor des Artikels nennen.
- Aus welcher Zeitung / Zeitschrift stammt der Artikel? Charakterisieren Sie diese Zeitung (Tages-, Wochenzeitung; Qualitätszeitung / Boulevardzeitung / Fachzeitschrift / Illustrierte….). Ist es eine etablierte / engagierte / …. Zeitung?
Darstellungsform
- Ist der Artikel tatsachen-, meinungs- oder phantasiebetont?
- Zu welcher journalistischen Darstellungsform gehört sie? Wie können Sie das nachweisen?
- Wie werden in diesem Artikel Tatsachen und Meinungen organisiert? Ist es dem Autor gelungen, sie voneinander abzutrennen? Oder war es nicht nötig? Zwingt der Artikel irgendwelche Idee oder eine persönliche Meinung auf?
Journalistische Funktionen des Artikels
- Gesellschaftliche Orientierung
- Meinungsbildung
- Service
- Unterhaltung
- Propaganda
- Aufklärung
- Politische Bildung
- Wirtschaftswissenschaftliche Bildung
- Kritik
- …
Inwieweit ist das Thema aktuell?
Sprache und Stilistik
- Welche sprachlichen / stilistischen Besonderheiten sind in diesem Artikel besonders auffällig? Welche Redeformen und stilistischen Figuren werden benutzt? Wie ist die kompositorische Textstruktur? (BEACHTEN SIE: am Ende müssen Sie die Frage beantworten, inwieweit die Komposition und die Sprache des Artikels seiner Darstellungsform entspricht.)
Schlussfolgerung
- Wie bewerten Sie den Artikel? War es wirklich nötig, diesen Artikel zu publizieren?
WICHTIG: Alle Ihre Ausführungen sollen mit den Textstellen belegt werden!!!
Lesen Sie folgenden Text, analysieren Sie ihn, diskutieren Sie dessen Inhalt und den Problemkreis in der Gruppe.
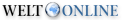
URL: http://www.welt.de/print-welt/article215176/Der_Journalismus_lebt_-_Essay.html
Der Artikel wurde erfolgreich verschickt!
Vielen Dank. Ihr Kommentar zu diesem Beitrag wurde veröffentlicht.
Ihr Leserbrief wurde an den Autor versendet.
8. Mai 2006, 00:00 Uhr
Von Mathias Döpfner
DER JOURNALISMUS LEBT - Essay
Die Presse hat immer Krisen erlebt. Auch neben dem Internet wird die Zeitung bestehen - bald ohne Papier. Ihren Lesern muss sie exklusive Neuigkeiten bieten, eigenständige Meinung und begeisternde Sprache
Den klügsten und kürzesten Satz über den richtigen Umgang mit Veränderung hat immer noch der Medienunternehmer Rupert Murdoch gesagt: "Embrace Progress! - Umarme den Fortschritt!" Das stimmt. Aber manchmal fällt es schwer. Denn hin und wieder weiß man vor lauter Fortschritt nicht so ganz genau, wen man nun gerade umarmen soll.
Vor einigen Monaten empfing ein Chefredakteur unseres Hauses eine Gruppe von Schülern zum Redaktionsbesuch. Er könne bis 23 Uhr auf aktuelle Ereignisse reagieren, durch die neue Computertechnologie sei die Druckplattenherstellung beschleunigt, ein paar Minuten nach der letzten Layout Änderung drucke er schon, und durch die ausgefeilteste Logistik sei er dann um 4 Uhr auf den Paletten der Grossisten und um 6 Uhr an allen deutschen Verkaufsstellen, also quasi beim Leser. Sein Blatt sei damit unschlagbar. Nachdem der Chefredakteur auf der eigenen Thermik zur stolzen Schluss Apotheose abgehoben hatte und nun die Runde um Fragen bat, meldete sich ein Schüler. "Heißt das, dass Sie um 23 Uhr alles wissen, was Sie uns in der Zeitung mitteilen wollen, und dass sich nach 23 Uhr bis zum nächsten Morgen nichts mehr ändern lässt?" "Ja, das heißt es natürlich." "Aber warum sollen wir dann bis zum nächsten Morgen warten? Schicken Sie uns die Zeitung doch um 23 Uhr per E-Mail." Der Chefredakteur war zerschmettert. Mit seinem Aktualitätsplädoyer sah der Print-Mann plötzlich ganz alt aus.
Das Erlebnis ist symptomatisch für die Verunsicherung unserer Branche. Die kollektive Angst ist so groß wie lange nicht. Nun ist die Krise für Zeitungsverleger nichts Neues. Als Johann Carolus vor 401 Jahren in Straßburg die erste Zeitung herausgab, drohte er schon zwölf Tage nach Ersterscheinen wieder mit der Einstellung. Beim Bürgermeister beklagte er sich über Kopisten, die ihm das Geschäft zerstörten. Am Anfang der Zeitung stand die Krise. Es war eine Urheberrechtskrise. Um 1900 herum war es dann eine Qualitätskrise, man fürchtete Banalisierung und Verflachung. Die nächste große Krise kam 50 Jahre später, als man die Existenz der Zeitung durch das Fernsehen bedroht sah. Dann kam die "Bild"-Zeitung, und während im Jahr 1900 nur zehn Prozent der Deutschen Zeitung lasen, waren es hundert Jahre später 73 Prozent. 1990 prophezeite Bill Gates, dass es im Jahr 2000 keine Zeitung mehr geben werde. Er täuschte sich. Im Jahr 2000 erwirtschafteten die Zeitungsverlage weltweit die höchsten Gewinne der Geschichte.
Und dennoch herrscht seit einigen Jahren wieder Krise. Die große Anzeigen-, Auflagen-, Internet- und Strukturkrise. Wir Medienmanager lieben die Krise. Wir brüsten uns geradezu damit, wer die Krise am schonungslosesten beschreibt. Niemand will Dinosaurier sein. Deswegen geben wir uns alle extrem veränderungsbereit und im Schumpeterschen Sinne zerstörungsfreudig. Auch ich. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht Selbstmord begehen aus Angst vor dem Sterben. Etwas überspitzt ausgedrückt lässt sich die Depression in unserer Branche auf zwei vorherrschende Thesen verkürzen:
Wir stehen kurz vor dem Untergang, denn alles im Verlagsgeschäft ändert sich. Wir werden nur dann nicht untergehen, wenn wir alles anders machen als bisher.
Diesen zwei Thesen möchte ich energisch widersprechen.
Wir werden nicht untergehen, denn es ändert sich weniger, als wir denken.
Wir dürfen nicht alles anders machen als bisher, denn sonst gehen wir wirklich unter.
Ich glaube an das "Rieplsche Gesetz". Wolfgang Riepl war Chefredakteur der Nürnberger Zeitung. 1913 veröffentlichte er eine Dissertation, die ein Gesetz aufstellte, das die Kommunikationsgeschichte geprägt hat: Keine neue Mediengattung ersetzt die bestehenden. Medienfortschritt verläuft kumulativ, nicht substituierend. Es kommt immer Neues hinzu, aber das Alte bleibt. Bis heute ist dieses Gesetz unwiderlegt. Das Buch hat die erzählte Geschichte nicht ersetzt. Die Zeitung hat das Buch nicht ersetzt, das Radio nicht die Zeitung, das Fernsehen auch nicht das Radio. Und also wird das Internet auch nicht das Fernsehen oder die Zeitung ersetzen. Das klingt beruhigend, wären da nicht folgende Ausnahmen. Die CD hat die alte Schallplatte sehr wohl ersetzt; und noch schneller als gedacht ist die MP3-Technologie im Begriff, die CD zu ersetzen. Für DVD und Video gilt das gleiche. Und genau hier wird es interessant. Denn weder CD noch DVD, noch MP3 sind wirklich neue Mediengattungen, sie sind lediglich bessere Technologien. Am Produkt, am Kreativmedium, der Musik oder dem Film, hat dieses Trägermedium nichts geändert. Deshalb sind auch diese beiden Beispiele Bestätigungen des Rieplschen Gesetzes.
Die Schlüsselfrage, die unsere Branche umtreibt, lautet: Wird die Zeitung, die gerade ihren 400. Geburtstag etwas misslaunig und depressiv feierte, ihren 500. Geburtstag noch erleben? Die Antwort lautet ja und nein. Als Trägermedium nein, als Kreativmedium ja. Als Informationsträger wird das Papier ersetzt werden. Durch elektronisches Papier. Als Funktion ist die Zeitung unersetzbar. Durch Journalismus. Das Internet ist nicht die neue Zeitung. Es ist ein wirklich neues Medium. Nicht nur ein neues Trägermedium, sondern eben auch ein neues Kreativmedium. Riepl zufolge heißt dies: Das Internet wird das bestehende Medienangebot ergänzen, nicht ersetzen.
Das Internet ist eine spektakuläre Erfolgsgeschichte. Mehr noch, es ist ein neuer Kosmos, der die Gesellschaft mehr verändert hat und verändern wird als die moderne Transporttechnik. Die erste Stufe der Globalisierung war das Flugzeug. Die zweite, entscheidende Stufe der Globalisierung ist das Internet. Jede Information ist für jedermann jederzeit überall verfügbar. Mit dieser radikaldemokratischen Großtat ist die Globalisierung unaufhaltsam geworden wie eine Naturgewalt. Sie ist das größte und unaufhaltsamste Sozialprojekt, die größte Umverteilungsaktion der jüngeren Geschichte: von reich zu arm, von Wissensinhabern zu Wissbegierigen, von Saturierten zu Hungrigen. Die etablierten Volkswirtschaften verlieren ihren Know-how- und Wohlstandsvorsprung gegenüber aufstrebenden Nationen wie Indien, China oder Osteuropa. Das sind die wirklichen Herausforderungen für das alte Europa: "Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden."
Globalisierter Journalismus, Internet-Journalismus unterscheidet sich grundlegend vom Zeitungsjournalismus. Denn er hat eine ganz andere Funktion. Im Internet erfahre ich schneller mehr über das, von dem ich schon weiß, dass es mich interessiert. Wenn ich etwas über eine Krankheit lernen will, gehe ich ins Internet. Über ein paar Links bin ich auf der Orthopäden-Spezial-Site, und ein paar Surf-Sekunden später hat mir eine Suchmaschine den geeigneten Arzt für meine Krankheit vermittelt. In der Zeitung dagegen erfahre ich etwas über Dinge, von denen ich noch gar nicht wusste, dass sie mich interessieren könnten. Ich wollte etwas über Rückenschmerzen lesen und bleibe an einem Text über Urlaub auf den Malediven hängen. Die Zeitung wirkt erweiternd, das Internet vertiefend. Die Zeitung funktioniert horizontal, das Internet vertikal. Der zweite Wesensunterschied ist: Im Internet führt der Nutzer den Journalisten. In der Zeitung wird der Leser geführt. Das Internet hat das Hierarchieverhältnis verkehrt. Es hat einen selbstlos antiautoritären, basisdemokratischen Gestus.
Die Zeitung hingegen einen selbstbewusst autoritären Gestus.
Die meisten Online-Angebote existierender Zeitungsmarken bleiben weit hinter den technischen, kreativen Möglichkeiten des Internets zurück. Nehmen wir eine große Themenlage. Etwa das Bombenattentat in der Londoner U-Bahn. Die Zeitungen bieten am nächsten Tag veraltete Informationen, das Fernsehen wiederholt die immer gleichen Filmsequenzen. Und das Internet? Es könnte der Sieger sein. Aber die meisten wiederholen nur Print-Agenturmeldungen und addieren die Fakten ein bisschen schneller als die Kollegen in den Zeitungsredaktionen.
User Generated Content ist hier das Schlüsselwort. Die Internet-Site der Zukunft hat nicht fünfzig, sondern fünfzig Millionen Reporter. Die Nutzer, die Kunden, sind Reporter. Eine südkoreanische Internet-Zeitung ("Ohmy-News" in Seoul) praktiziert das vorbildlich und lobt an die besten Beiträge sogar Honorare aus, über deren Höhe die Anzahl der Klicks entscheidet. Wir sehen: Der Kunde, der Nutzer, ist hier der Chef. Der Online-Journalist ist der Untergebene. Er tut, was man ihm aufträgt.
Ist das die Zukunft? Ja. Es ist ein Teil der Zukunft. Aber was bedeutet das für die Zeitung? Muss sie - wie Rupert Murdoch und andere das fordern - auch so flexibel und interaktiv nach den Wünschen des Lesers orientiert sein, muss sie Fast Food werden, konsumierbar on jemand, muss sie im Grunde versuchen, so zu werden wie das Internet? Ich glaube nein. Die Zeitung muss sich auf sich selbst, auf ihre Stärken besinnen, und das heißt: als Horizont-Medium Wünsche und Interessen schaffen und befriedigen, von denen der Leser noch gar nicht wusste, dass er sie haben könnte. Das war und bleibt ihre Zukunft, ganz gleich, ob sie auf Papier oder auf elektronischem Papier daherkommt. Denn davon bin ich überzeugt: Die Zukunft der Zeitung ist digital. Die Zeitung wird genau zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf Papier gedruckt werden, wenn ein elektronisches Papier vorliegt, das folgende Eigenschaften erfüllt: Es muss dünn, falt- und rollbar sein, hochauflösende Vierfarbbilder produzieren, per Touchscreen idiotensicher funktionieren, keine schweren Batterien oder Ladegeräte benötigen, und es muss billig sein. Dann rollen wir unsere Zeitung aus dem Handy oder aus dem Kugelschreiber. Dann rufen wir unser Zeitungsabo per Fingerdruck ab. Solche E-Papers werden längst entwickelt. Dann, in fünf, zehn, oder fünfundzwanzig Jahren, verteilen wir dieses elektronische Papier zum Abonnement an unsere Kunden. Die Papierkosten, Druckkosten, Vertriebskosten sinken dramatisch - an unserem Geschäftsmodell aber hat sich nichts geändert. Information und Unterhaltung für verschiedene Zielgruppen. Oder anders ausgedrückt: Exklusive Neuigkeiten, eigenständige Meinungen und eindringliche Sprache - kurz Journalismus.
Wir Verlagsmanager müssen uns deshalb noch bewusster werden, dass unser Geschäft nicht das Bedrucken von Papier ist, sondern Journalismus. Journalismus im Internet und Zeitungsjournalismus. Und beide folgen unterschiedlichen Gesetzen. Denn von einem bin ich überzeugt: Wenn jede Information für jedermann jederzeit überall verfügbar ist, dann wächst das Bedürfnis nach Orientierung, Auswahl oder dem, was den guten Zeitungsjournalisten ausmacht: Führung.
Drei Gramm Fußball, zehn Löffel Rentenpolitik, fünf Prisen Kinobericht und etwas außenpolitische Sauce mit Nahostgeschmack. Morgens um sieben am Laptop. Und nachts um halb elf auf dem Flat Screen im Schlafzimmer. Sieht so das Rezept zum mündigen Medienkonsumenten der Zukunft aus? Auf Dauer will nicht jeder sein eigener Programmdirektor sein. Das ist eine demokratie- und medientheoretisch schöne Utopie für eine kleine Elite, realitätstauglich für den Massenmarkt ist sie nicht. Leser wollen nicht ständig selbst entscheiden. Man will ja auch nicht immer selbst kochen, wenn man Hunger hat.
Leser wollen Orientierung. Wollen Vorauswahl. Aus den antiautoritären Kindergärten der siebziger Jahre ist folgender Satz eines Pädagogikopfers überliefert: "Mama, müssen wir heute schon wieder das spielen, was wir wollen?" Das paraphrasierend könnte man fragen: Will der Leser wirklich immer etwas wollen müssen? Das Prinzip Zeitung ist das Prinzip Führung. Das macht sie so scheinbar altmodisch. Und das Prinzip Führung macht die Zeitung zugleich so zukunftssicher. Denn an das Prinzip Führung, an eine tiefe Sehnsucht nach Hierarchie, glaube ich genauso fest wie an die Funktion des Marktplatzes. Die Menschen wollen dort hin, wo sich möglichst viele treffen, um Informationen und Meinung und Waren auszutauschen. Je fraktionierter, vielfältiger, zerklüfteter die Medienlandschaft wird, durch immer mehr Spartenkanäle, Special-Interest-Zeitschriften und Internet-Sites, desto größer wird auf der anderen Seite das Bedürfnis nach einem gesprächsstiftenden Kommunikationserlebnis. Nach der großen Marke. Nach der großen Fernsehsendung. Nach der großen Zeitung. In dieser von allen Moden und Trends unabhängigen Sehnsucht liegt die Chance.
Wir müssen allerdings aufpassen, dass wir es auf dem Weg zu mehr Leserfreundlichkeit nicht übertreiben und aus Kundenorientierung Orientierungslosigkeit und Charisma Verlust wird. Am Ende könnte es den Medien gehen wie den Politikern. Deren Bedeutungs- und Ansehensverlust ist beschleunigt worden, seitdem sie versuchen, ihren Wählern (und den Medien) nach dem Mund zu regieren. Demoskopie-Demokratie ist das, wenn das politische Führungspersonal aufhört, Mehrheiten für das politisch Richtige zu organisieren, und stattdessen Demoskopen beauftragt, herauszufinden, was das Volk hören will. Kurzfristig mag man das wohltuend finden, langfristig verliert man Achtung und Interesse. Für Zeitungsjournalismus gilt das auch. Wer Konzepte, Blattmischungen nach Marktforschungsergebnissen gestaltet, hat langfristig verloren. Jahrelang hieß das Ergebnis weltweiter Copy-Tests: weniger Politik, weniger Kultur, mehr Sport, mehr Lokales. Jetzt gibt es "Reader Scan", sozusagen die Quotenmessung des Print-Gewerbes, das heißt die harte Dokumentation tatsächlich gelesener Texte. Und zur allgemeinen Verwunderung: Sport wird nur von 25 Prozent gelesen. Und die Leute wollen, selbst in der Lokalzeitung, weniger Lokales und mehr Überregionales. Was nun? Schmeißen wir jetzt Sport und Lokales aus unseren Zeitungen? Marktforschung ist eine Leitplanke, aber niemals die Straße zum Erfolg.
Mich erinnert das Ganze manchmal an das Phänomen, das ich das Türsteher-Syndrom nenne. Ich kenne nur zwei Kategorien von Diskotheken oder Clubs. Die eine: Da steht einer vor der Tür und ruft laut: hereinspaziert, hereinspaziert, schöne Mädchen, heute Eintritt kostenlos, hereinspaziert - da wechseln alle, die nicht völlig verzweifelt sind, schnell die Straßenseite. Und die andere Kategorie: Da steht einer hinter der Tür und sagt, tut mir leid, heute nur für Clubgäste - und alle stehen Schlange.
Was also will der Zeitungsleser? Die Zeitung von morgen wird genau das auszeichnen, was auch schon die Zeitung von gestern ausgezeichnet hat: exklusive Neuigkeiten, eigenständige Meinungen und eine eindringliche Sprache. Wie ist es um diese drei Kompetenzkerne bestellt?
Exklusive Neuigkeiten. Zeitung heißt Neuigkeit. Das, was noch niemand weiß (das heißt also nicht die allseits verfügbare Agenturmeldung), und das, was eigentlich niemand erfahren sollte (wenn es nach den Betroffenen ginge), ist also das Urelement, die eigentliche Funktion und Existenzberechtigung der Zeitung. Neues erfährt man nur durch Recherchen. Hans Leyen Decker weist darauf hin, dass manche in Deutschland schon unter Recherche verstehen, wenn man eine Telefonnummer ohne Sekretärin findet. Zeitungen müssen, wenn sie modern bleiben und im härter werdenden Kampf um das Zeitbudget der Kunden mithalten wollen, mehr Wert auf eigene Recherchen legen. Und Verlage müssen die Bedingungen dafür erhalten oder schaffen: Geld, Zeit, Unabhängigkeit. Investigatives Arbeiten kostet Geld, es kann dauern und auch mal ergebnislos verlaufen. Aber es macht sich à la longue bezahlt.
Eigenständige Meinungen. Zeitungen leben neben Nachrichten von Meinungen. Und zwar von möglichst klugen, pointiert vorgetragenen, bisweilen sogar provozierenden und polemischen. Nichts ist langweiliger als das Einerseits-Andererseits oder dem Leser nach dem Mund zu schreiben. Zeitungen müssen Gesprächsstoff bieten. Sie sind das Briefing für das Gespräch auf dem Büro Flur oder in der Kneipe. In Deutschland aber dominiert immer noch und mehr denn je eine Konsenskultur. Die Zeit leidenschaftlicher Debatten ist nie vorbei. Es muss nur welche geben, die Debatten leidenschaftlich anzetteln. Nichts geht über den guten alten Leitartikel: Hier haut die Redaktion auf den Tisch und bekennt, was sie oder eines ihrer Mitglieder denkt.
Und schließlich: Eindringliche Sprache. Sprache ist Werkstoff des Journalisten und Aphrodisiakum zur Verführung des Lesers. Es gibt bekanntlich keine langweiligen Themen, es gibt nur langweilig geschriebene Texte. Autoren gelten den Verlagen als Orchideen, teuer und empfindlich. Dabei sind diese Sprachkünstler, sind Kolumnen wie das "Streiflicht" in der "Süddeutschen Zeitung", "Zipper zappt" in der WELT, "Post von Wagner" in der "Bild"-Zeitung und die großen Reportagen, die wir nie lesen wollten, aber nachdem wir die ersten zwei Sätze gelesen hatten, dann doch zu Ende lesen mussten, die wichtigsten Anker. Sprache ist das Pfund, mit dem Zeitungsjournalismus, anders als Radio, Fernsehen, Internet, wuchern kann und wuchern muss. Das, was zwischen den Zeilen steht, die genaue Beobachtung, das ironisch verfremdete Detail, die ungewöhnlich treffende Formulierung und vielleicht sogar das Lachen des Lesers - das ist der Kitt zwischen dem Leser und seinem Blatt.
Neuigkeiten, Meinungen, Sprache - darum geht es in Zukunft, und darum ging es immer.
Die erfolgreichsten Journalisten und Chefredakteure dieser Tage sind keine, die auf Verlagstagungen die schicksten Charts zeigen und Anzeigenkunden nach dem Mund reden. Es sind die Unbequemen, Anspruchsvollen, Anstrengenden. Es sind die Selbstbewussten. Wohlgemerkt nicht die Selbstzufriedenen. Unter den Selbstbewussten also nur die, bei denen die Fähigkeit zur Selbstkritik immer noch stärker ausgeprägt ist als die Fähigkeit zur Selbstzufriedenheit.
Die Zukunft gehört Journalisten und Verlegern, die daran glauben, dass die Zeitung nicht tot ist, solange man neue Zeitungen und Zeitschriften mit Millionenauflagen gründen kann, solange sich - wie in Frankreich - eine Kindertageszeitung zum reichweitenstärksten Blatt des Landes entwickeln kann und solange Neuigkeiten, Meinungen, Sprache die Menschen begeistern.
Rupert Murdoch hat in seiner vielbeachteten Rede geschrieben: "Was passiert, ist - kurz gesagt - eine Revolution in der Art, wie sich junge Leute Nachrichten nähern. Sie wollen sich nicht auf eine Morgenzeitung zur aktuellen Information verlassen. Sie wollen sich nicht auf eine gottartige Figur verlassen, die ihnen sagt, was wichtig ist. Und um die Religionsanalogie noch weiterzutreiben: Ganz sicher wollen sie Nachrichten nicht präsentiert haben wie Gospel." Natürlich hat Murdoch - wie immer - Recht. Aber ich möchte doch dreimal kurz widersprechen:
Erstens: Ich glaube, dass junge Menschen auch in Zukunft morgens eine Zeitung lesen, auf Papier oder elektronischem Papier, wenn sie sich mit ihrer Lebenswirklichkeit, mit ihren Themen, mit ihren Problemen und Träumen beschäftigt; kurz: wenn die Neuigkeiten, Gedanken und die Sprache dieser Zeitung sie begeistern.
Zweitens: Ich glaube, dass die Zeitung der Zukunft sie nur begeistern kann, wenn dahinter vielleicht nicht gottgleiche, aber auf jeden Fall selbstbewusste, charismatische Führungsfiguren stehen, die es verstehen, das begeisternd darzustellen, wofür sie sich selbst begeistern. Die Ansprüche der Jugend an Layout, Sprache und Inhalt sind heute höher als noch vor zwanzig Jahren. Trash hat sie satt. Substanz ist gefragt - auf unterschiedliche Weise in der Qualitätszeitung und auf dem Boulevard.
Und drittens: Eine bessere Metapher für guten Journalismus als Gospel kann ich mir kaum vorstellen. Gospel ist Bewegung (groove), Gospel ist Geist (Spirit) und Gospel ist Seele (Soul). Guter Gospel bewegt die ganze Gemeinde. Und bewegen wollen wir doch.
Guter Journalismus bewegt. Bei allem, was sich ändert - das bleibt.
Machen Sie ihre Recherche zur Frage, welche Massenmedien heute besonders gefragt sind und wie sie vertreten sind. Illustrieren Sie Ihre Recherche mit aktuellen Grafiken und Statistik.
2. Analysieren Sie die Angaben folgenden Textes. Sagen Sie, ob dieses Problem auch für Ihr Land aktuell ist? Welche Lösungen würden Sie vorschlagen, damit es zu der Abwanderung der wissenschaftlichen Elite nicht käme?

AktuellHintergründe
Bildung
Wandern die Eliten wirklich aus?
Von Jürgen Kaube

Hängt wirklich jeder siebte deutsche Doktorhut in Amerika?
27. Februar 2006 In den letzten Jahren ist viel über den "brain drain", das Abwandern deutscher Forscher ins Ausland, berichtet worden. Nach dem Verlust an wissenschaftlichen Eliten als einer Folge der Verfolgungspolitik des Dritten Reichs komme es nun unter den Umständen der Globalisierung zu einer zweiten großen Flucht der Intelligenz aus Deutschland.
Heute sind es die andernorts besseren Ausstattungen für Forscher, im Fall der Biotechnologie die liberaleren Gesetze, die bessere Bezahlung oder die klügere Hochschulpolitik in den Vereinigten Staaten, die als Gründe für die Migration von Wissenschaftlern, aber auch Ingenieuren und Computerspezialisten angegeben werden.
Date: 2015-12-11; view: 984
| <== previous page | | | next page ==> |
| Vor, wundert sich zu machen | | | Nur wenige Auswanderer gehen dauerhaft weg |